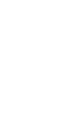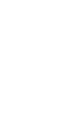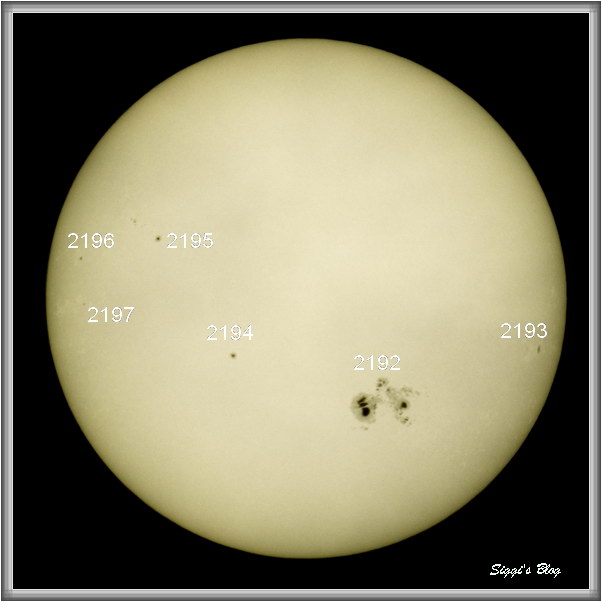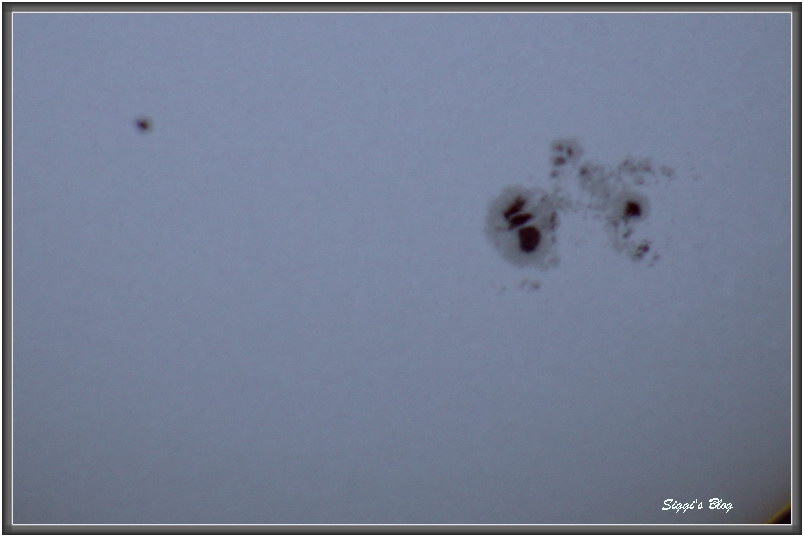Seit zwei Jahren habe ich mich jetzt mit einer Solarstromanlage gespielt:
3×100 Wp Monokristalline Solarpanels am Schuppendach Richtung Südsüdwest. Sie sind parallel geschaltet, die Leerlaufspannung beträgt maximal 22V, damit kann einem mal selbst nichts passieren, sollte man in den Stromkreis kommen. Allerdings, bei geringer Spannung braucht man schon dicke Leitungskabel, um den Maximalen Strom von ca. 260W auch zu transportieren. Das können schon mal 20A sein!. Beim „Leistungsschalter“, womit ich im Bedarfsfall den Strom unterbrechen kann, bin ich bei den Auto HiFi Anlagen Zubehör fündig geworden.
Zur schnellen Kontrolle, wie viel Leistung von den Solarzellen fließen, habe ich mir beim „großen Fluss“ zwei günstige analoge Volt- und Amperemeter besorgt: V*A=Leistung in Watt 🙂
Hier meine Stromproduktion am 24.12.2015 um 14:20 bei Sonnenschein und tief stehender Wintersonne:
Also ca. 90 W Produktion.Bei Sonnenschein am 25.12. wurden zwischen 11:00 und 13:30 120W geliefert. Das sind immerhin 0,3 kWh Ertrag. Leider ist aber gerade im Winter oft bewölkt oder falls es schön wäre Hochnebel.
Was oft eine Rolle spielt ist leichter Dunst, der senkt den Ertrag vor allem im Sommer merkbar ab. Aber auch die Temperatur. Kalte Solarzellen liefern eine bessere Ausbeute.
Wer das Maximum herausholen will, sollte die Solarpanele möglichst sauber halten und im Winter vom Schnee befreien.
Egal, man freut sich!!
Ein paar Messwerte: Zeit: Watt (MPPT -Regler: V/A)
7.1.
11:30 152W (16Vx9,5A)
20.1. Morgens: -12 Grad Mittag: -3 leicht dunstig
10:30 112W (16Vx7A) 11:00 128W (16V*8A) 12:00 148W (16,5V/9A) 13:00 144W 14:00 136W 15:00 80W
30.1. Etwas nebelig:
9:30 82W (15×5,5 ) 10:00 105W 11:00 142W(15×9,5) 12:00 150W
6.2.
9:30 77W 10:30 95W 11:30 105W 12:00 176W 14:30 120W
13.2.
9:00 105W 10:00 128W 11:00 160W 14:00 186W 15:00 110W
13.2.
8:30 60W 9:00 93W 9:30 116W 11:00 187W 11:30 195W
18.3.
10:00 160W (16/10) 10:30 176 (16/11) 12:30 200W (16/12) 13:30 192 (16/12) 15:00 160W (16/10)
27.3.
11:00-14:00 204W (17/12)
10.9.
9:00 75W 10:00 140W 11:00-14:30 176W (16V/11A) 15:00 168W 16:00 144W 17:30 128W
16.11.
9:00 36W 9:30 120W
25.12.
9:30 80W (17/5) 10:00 100W (17/6)
26.12.
10:30 102W (17/6) 12:00: 138W (17/8) 12:30 130W (17/7,7) 13:00 127W (17/7.5) 13:30 120W (17/7)
30.12.
10:30 128W 12:00 144W 14:00 112W 14:30 8W