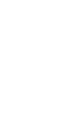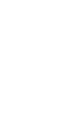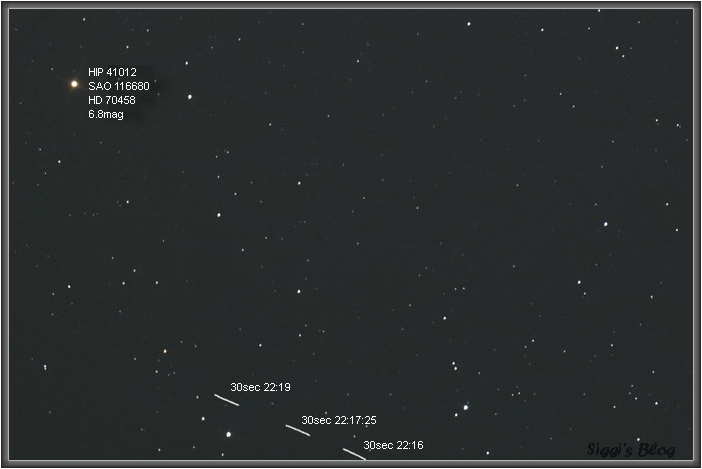Der ausgedehnte Kaltluftzustrom aus dem Norden beherrschte auch Anfang Sommer die erste Woche. Die Tiefstwerte bei klaren Morgennächten erreichte 6 Grad und die Tageshöchstwerte stiegen erst allmählich auf über 25 Grad.
Richtig heiß wurde es dann Anfang Juli. Ein ausgedehntes Hochdruckgebiet sorgte für Temperaturen von über 30 Grad. Die Tiefstwerte am frühen morgen lagen bei 16 Grad. Die erste Hitzewelle ging dann bis 7.Juli mit Temperaturen bis 35 Grad. Eine Kaltfront aus NW näherte sich und das ansaugen warmer Luftmassen bewirkte 3 Uhr morgens einen eklatanten Temperaturanstieg auf 29 Grad! Es war Österreich weit die wärmste Nacht, die je registriert wurde. Die Kaltfront brachte in Kärnten, Steiermark und Burgenland heftige Unwetter. Bei uns gut 10mm Regen. Danach ginge es etwas unbeständiger mit vereinzelten lokalen Regenschauern weiter. Die Temperaturen blieben zwischen 20 und 27 Grad. Danach gab es die längste Hitzeperiode seit Aufzeichnungen, wobei. Es aber wenigstens nicht die letztjährigen Spitzenwerte erreicht wurden. Ab und zu brachte eine Westfront hier ein paar mm Regen, aber kaum Abkühlung. Kärnten wurde aber zweimal von heftigen Hagelschlägen heimgesucht. Durch das trocken heiße Wetter war die Waldbrandgefahr noch nie so hoch. Gegen Ende Juli wurde es dann normales Sommerwetter: Zwischen einem Italien Hochdruckgebiet und einem Nördlichem Tiefdruckgebiet werden immer wieder feuchte kühlere Atlantikluftmassen von West nach Ost durch Österreich geführt. Damit bleiben die Temperaturen dann um die 25 Grad und ab und zu gibt es etwas Regen. Richtig angenehm, nach der Hitzeperiode. Es war insgesamt aber ein sehr trockener Juli und der wärmste seit Wetteraufzeichnungen in Österreich.
So wie der Juli endete ging es im August mit einer 3. Hitzewelle weiter. Im Osten Österreichs gab es wieder durchgehend Temperaturen über 35 Grad am Tag. Da es weiterhin nicht regnete, war es so trocken wie nie. Beendet wurde die langanhaltende Hitzewelle am 15.8. gegen Mittag als uns eine Kaltfront erreichte. Im wesentlichen gab es zwei größerer Regenereignisse, die die dann in Summe 54mm Regen brachten. In weiterer Folge blieben die Tagestemperaturen dann um die 25 Grad. Bei sternklaren Nächten kühlte es schon auf 12 Grad ab, wo auch der Taupunkt lag. Es ging dann recht Warm weiter, wenn auch nicht mehr so heiß wie die vorangegangenen Hitzewellen. Die Luft war aber schon sehr feucht, sodass sich Nach Mitternacht Nebel bildetet, der sich erst am späteren Vormittag auflöste. in Summe war es der viertwärmste August und durchgehend einer der trockensten seit Wetteraufzeichnunge des ZAMG. Der meteorologische Sommer ebenfalls durch die 5. Hitzewelle recht heiß.
Am 1.September war dann der letzte Tag der Hitzewelle 2015, wodurch dieser als zweit wärmster Septembertag seit Wetteraufzeichnung verzeichnet wurde. Dann kam es zu einem Kaltfronteinbrauch, der etwas Regen brachte. Kalte Atlantikluft mische sich mit warmen Luftmassen.
In der zweiten Septemberwoche bestimmte dann ein Höhentief östlich von Österreich das Wettergeschehen im Nordosten: Es steuerte immer wieder Wolken herein. So war kam es auch immer wieder mal zu Niederschlägen. Die Nachttemperaturen lagen schon zwischen 5-10 Grad, was natürlich schon zu Nebelbildung führte. Daher erreichten die Tageshöchstwerte kaum über 20 Grad. Dafür war die Sonneinstrahlung schon zu kurz, musste sie doch morgens zuerst den Nebel auflösen. Dann gab der Spätsommer bei einer Föhnlage nochmals richtig Gas: 30 Grad wurden erreicht. Pünktlich zu Herbstbeginn zog wieder eine Kaltfront durch.